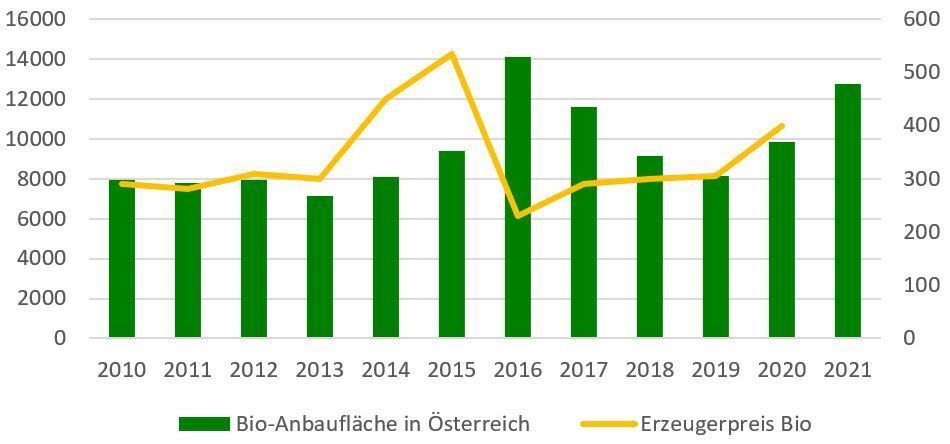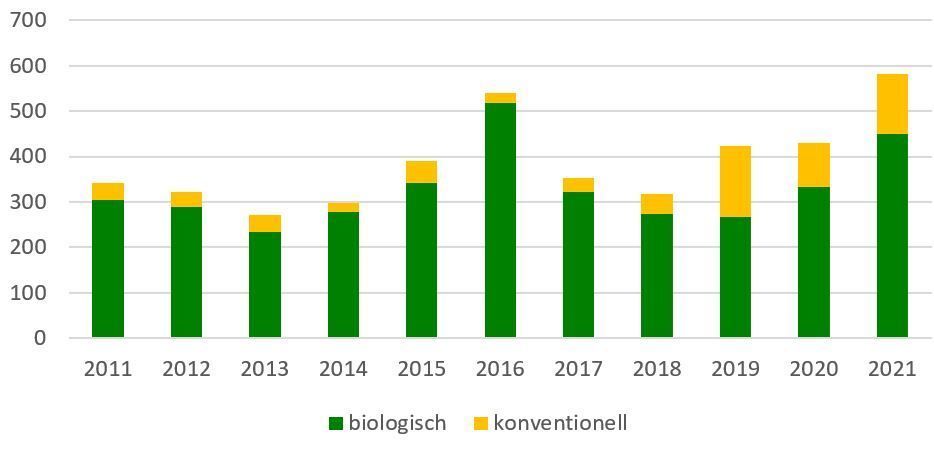Dinkel – gesund und anspruchslos

Dinkel ist eine alte und züchterisch noch weniger bearbeitete Weizenart. Lange Zeit stellte er die wichtigste Getreideart im Alpenraum dar, weshalb er oft nur als "Korn“ bezeichnet wurde. Der Anbauumfang ist im letzten Jahrhundert jedoch deutlich zurückgegangen. Mit aufkommender Pflanzenzüchtung verringerte sich der Anbau zunehmend und wurde in Richtung Weizen als Hauptbrotgetreide verschoben. Die Vorteile des Weizenanbaus liegen vorrangig im höheren Ertrag, vor allem in Gunstlagen. Dies beruht auf der deutlich höheren möglichen Bewirtschaftungsintensität, da bei alten Dinkelsorten bei Überdüngung die Lagergefahr deutlich höher ist. Zudem entfällt die Mehrarbeit für das Entspelzen oder auch Gerben in den Verarbeitungsbetrieben. Dennoch konnte sich der Dinkel in Grenzregionen des Ackerbaus aufgrund seiner positiven pflanzenbaulichen Eigenschaft, zu der in erster Linie Anspruchslosigkeit und Robustheit zählen, halten. Diese Eigenschaften machen ihn seit jeher auch für den Biolandbau interessant. Ein Comeback erfuhr der Dinkel in den letzten Jahrzehnten mit den steigenden Ansprüchen der Konsumenten. So gilt er als gesündere Alternative im Vergleich zum herkömmlichen Weizen. Bäcker schätzen seinen höheren Protein- und Klebergehalt. Um jedoch die Erwartungen der Abnehmer zu erfüllen, müssen auch beim Dinkelanbau einige Kriterien beachtet werden.
Standortansprüche und Fruchtfolge
Dinkel bevorzugt gute und tiefgründige, ausreichend mit Nährstoffen versorgte Böden. Zwar kommt er auch auf schlechteren Standorten und mit weniger Nährstoffen gut zurecht, allerdings leiden darunter Ertrag und Qualität des Ernteproduktes. Hinsichtlich Fruchtfolgestellung wird er meist alternativ zu Weizen angebaut, betreffend Ansprüche steht Dinkel zwischen Weizen und Roggen. Als günstige Vorfrüchte eignen sich Leguminosen bzw. Mais oder Kartoffel. Aufgrund der geringen Standfestigkeit ist der Anbau nach Körnerleguminosen jenem nach Kleegras vorzuziehen. Um Fußkrankheiten zu vermeiden, sind Anbauabstände von zwei Jahren zu Getreide, insbesondere zu Dinkel und Weizen sowie Gerste , einzuhalten, während Hafer als Vorfrucht grundsätzlich möglich ist.
Sortenwahl bzw. Sortenfrage
Für den Dinkelanbau stehen mehrere Sorten zur Verfügung, wobei man grundsätzlich die Überlegung anstellen muss, ob man eine alte SLK-fähige Sorte oder eine neuere Züchtung mit höherem Weizenanteil und mit höherem Ertragspotenzial auswählt. Entscheidend ist sicherlich, ob es seitens der Abnehmer (Endkonsument bzw. Händler) spezifische Wünsche bzw. Auflagen gibt. Ältere Sorten bieten den Vorteil, dass man an der ÖPUL-Maßnahme "Anbau seltener landwirtschaftlicher Kulturpflanzen (SLK)“ teilnehmen kann (Förderhöhe: 120 Euro/ha). Zudem sind ältere Sorten meist langstrohiger, was für viehhaltende Betriebe nicht unwesentlich ist. Darüber hinaus verfügen diese Sorten über eine bessere Unkrautunterdrückung. Neue Sorten wie z.B. Zollernspelz sind hingegen auf Ertrag gezüchtet, sind kurzstrohiger und verfügen über eine geringe Lagerneigung. Damit eigenen sich diese Sorten auch für konventionelle Betriebe, da sie in der Lage sind, das Ertragspotenzial besser auszunützen und mit ihnen ähnlich hohe Erträge wie bei anderen Getreidearten erreicht werden können.
Empfohlene Sorten:
Dinkel - SLK-fähige Sorten
Empfohlene Sorten:
Dinkel - SLK-fähige Sorten
- Attergauer Dinkel
- Ebners Rotkorn
- Ostro
- Steiners Roter Tiroler
- Comburger
- Filderweiss
- Zollernspelz
Problemlose Lagerung nach Ernte
Die Ernte erfolgt Ende Juli bzw. Anfang August, wenn möglich mit einem Feuchtigkeitsgehalt kleiner 14%. Beim Dreschen muss darauf geachtet werden, dass die Ähre vollständig in die einzelnen Spindelglieder gebrochen wird, der Anteil an freidreschender Körner aber so gering wie möglich ist. Dies ist zum Teil sortenabhängig. Nach der Ernte kann Dinkel mit einem Feuchtigkeitsgehalt von 14% bei einer Lagertemperatur unter 20 °C problemlos gelagert werden.
Die Erntemengen hängen neben den Wachstumsbedingungen zum Teil auch von den verwendeten Sorten ab. Sie liegen im Biolandbau zwischen 30 und 45 dt/ha. Höhere Erträge bis zu 50 dt/ha können nur mit neuen Züchtungen aufgrund der geringen Wuchshöhe in Verbindung mit höheren Düngergaben erreicht werden. Diese Sorten sind allerdings nicht SLK-tauglich. Bei konventioneller Bewirtschaftung kann mit Erträgen zwischen 45 und 65 dt pro Hektar gerechnet werden.
Die Erntemengen hängen neben den Wachstumsbedingungen zum Teil auch von den verwendeten Sorten ab. Sie liegen im Biolandbau zwischen 30 und 45 dt/ha. Höhere Erträge bis zu 50 dt/ha können nur mit neuen Züchtungen aufgrund der geringen Wuchshöhe in Verbindung mit höheren Düngergaben erreicht werden. Diese Sorten sind allerdings nicht SLK-tauglich. Bei konventioneller Bewirtschaftung kann mit Erträgen zwischen 45 und 65 dt pro Hektar gerechnet werden.
Anbau und Kulturführung
Dinkel wird üblicherweise im Spelz gesät, das bringt deutliche Vorteile in der Jugendentwicklung, da die Körner vor Krankheiten geschützt sind. Nachteilig dabei ist die Verstopfungsgefahr bei der Aussaat aufgrund der voluminösen Vesen. Diese kann durch eine geringere Arbeitsgeschwindigkeit vermindert werden. Seit kurzem wird aber auch entspelztes Saatgut angeboten. Da Dinkel oft nachgebaut wird, ist zumindest eine Teilentspelzung zu überlegen. Die Saatstärke ist abhängig vom Zeitpunkt der Aussaat. Üblicherweise wird Dinkel zwischen Anfang und Mitte Oktober mit einer Saatstärke von 150 bis 180 Vesen/m² angebaut. Das entspricht einer Saatgutmenge von ca. 180 bis 200 kg/ha. Da der Spelzanteil bei rund 30% liegt, kann die Aussaatmenge bei der Verwendung von entspelztem Saatgut um diesen Anteil verringert werden. Dinkel verträgt ohne Probleme auch spätere Aussaaten. In diesem Fall muss die Aussaatmenge um ca. zehn Prozent erhöht werden.
Eine ausreichende Nährstoffversorgung der Pflanze erfolgt aus der Vorfrucht. Aufgrund der Lagergefahr sollte je nach Sorte nur verhalten gedüngt werden, wobei in diesem Fall eine Düngung zeitig im Frühjahr zur Bestockung möglich ist. Überdüngte Bestände neigen zum Lagern, wobei vor allem neuere und kurzstrohigere Sorten eine deutlich höhere Bewirtschaftungsintensität zulassen. Der Entzug liegt bei rund 20 kg N, 8 kg P2O5 und 6 kg K2O pro Tonne Erntegut und Hektar. Nach der Düngung erfolgt idealerweise eine Unkrautregulierung mittels Striegel.
Dinkel verfügt aufgrund seiner Wuchshöhe über eine sehr gute Konkurrenzkraft gegenüber Unkräutern. Im biologischen Landbau kann mit ein bis zwei Striegeldurchgängen ein sauberer Bestand erzielt werden. Ein günstiger Zeitpunkt für das Striegeln ist das Drei- bis Vier-Blattstadium des Dinkels, wobei man sich allerdings vorrangig am Entwicklungsstadium der Unkräuter orientieren sollte. Der Regulierungserfolg ist am größten, wenn sich das Unkraut im Keimblattstadium befindet. Gestriegelt wird idealerweise am Nachmittag, wenn aufgrund der höheren Temperaturen die Verletzungsgefahr der Kulturpflanzen geringer ist.
Eine ausreichende Nährstoffversorgung der Pflanze erfolgt aus der Vorfrucht. Aufgrund der Lagergefahr sollte je nach Sorte nur verhalten gedüngt werden, wobei in diesem Fall eine Düngung zeitig im Frühjahr zur Bestockung möglich ist. Überdüngte Bestände neigen zum Lagern, wobei vor allem neuere und kurzstrohigere Sorten eine deutlich höhere Bewirtschaftungsintensität zulassen. Der Entzug liegt bei rund 20 kg N, 8 kg P2O5 und 6 kg K2O pro Tonne Erntegut und Hektar. Nach der Düngung erfolgt idealerweise eine Unkrautregulierung mittels Striegel.
Dinkel verfügt aufgrund seiner Wuchshöhe über eine sehr gute Konkurrenzkraft gegenüber Unkräutern. Im biologischen Landbau kann mit ein bis zwei Striegeldurchgängen ein sauberer Bestand erzielt werden. Ein günstiger Zeitpunkt für das Striegeln ist das Drei- bis Vier-Blattstadium des Dinkels, wobei man sich allerdings vorrangig am Entwicklungsstadium der Unkräuter orientieren sollte. Der Regulierungserfolg ist am größten, wenn sich das Unkraut im Keimblattstadium befindet. Gestriegelt wird idealerweise am Nachmittag, wenn aufgrund der höheren Temperaturen die Verletzungsgefahr der Kulturpflanzen geringer ist.