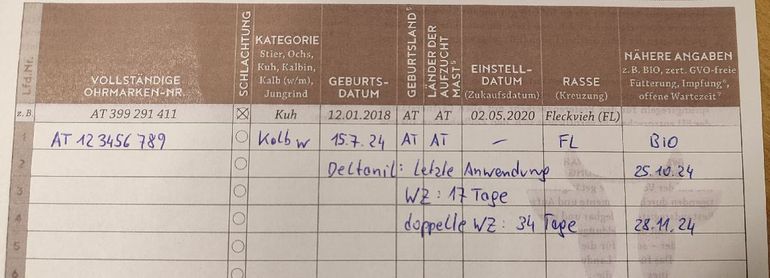Kennzeichnung von Bio-Tieren mit offenen Wartezeiten
Hierbei muss klar zwischen behandelter Tiere zur weiteren (Lebend-)Nutzung und Tiere zur Schlachtung unterschieden werden:
G: Tierhalter:in bestätigt, dass das genannte Tier frei von Krankheitssymptomen ist
R: Tierhalter:in bestätigt, dass das genannte Tier mit Repellentien behandelt wurde
- Tiere zur weiteren Nutzung
- Tiere zur Schlachtung und Gewinnung von Lebensmitteln
- Zusätzliche Angaben in Bezug auf Blauzunge
G: Tierhalter:in bestätigt, dass das genannte Tier frei von Krankheitssymptomen ist
R: Tierhalter:in bestätigt, dass das genannte Tier mit Repellentien behandelt wurde